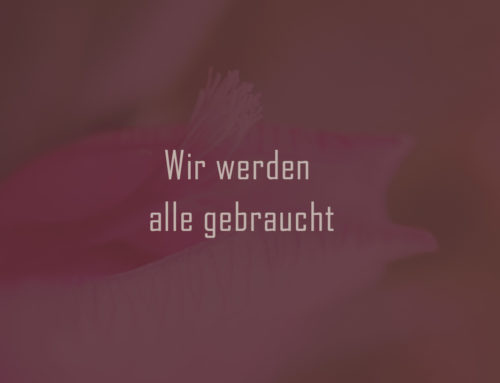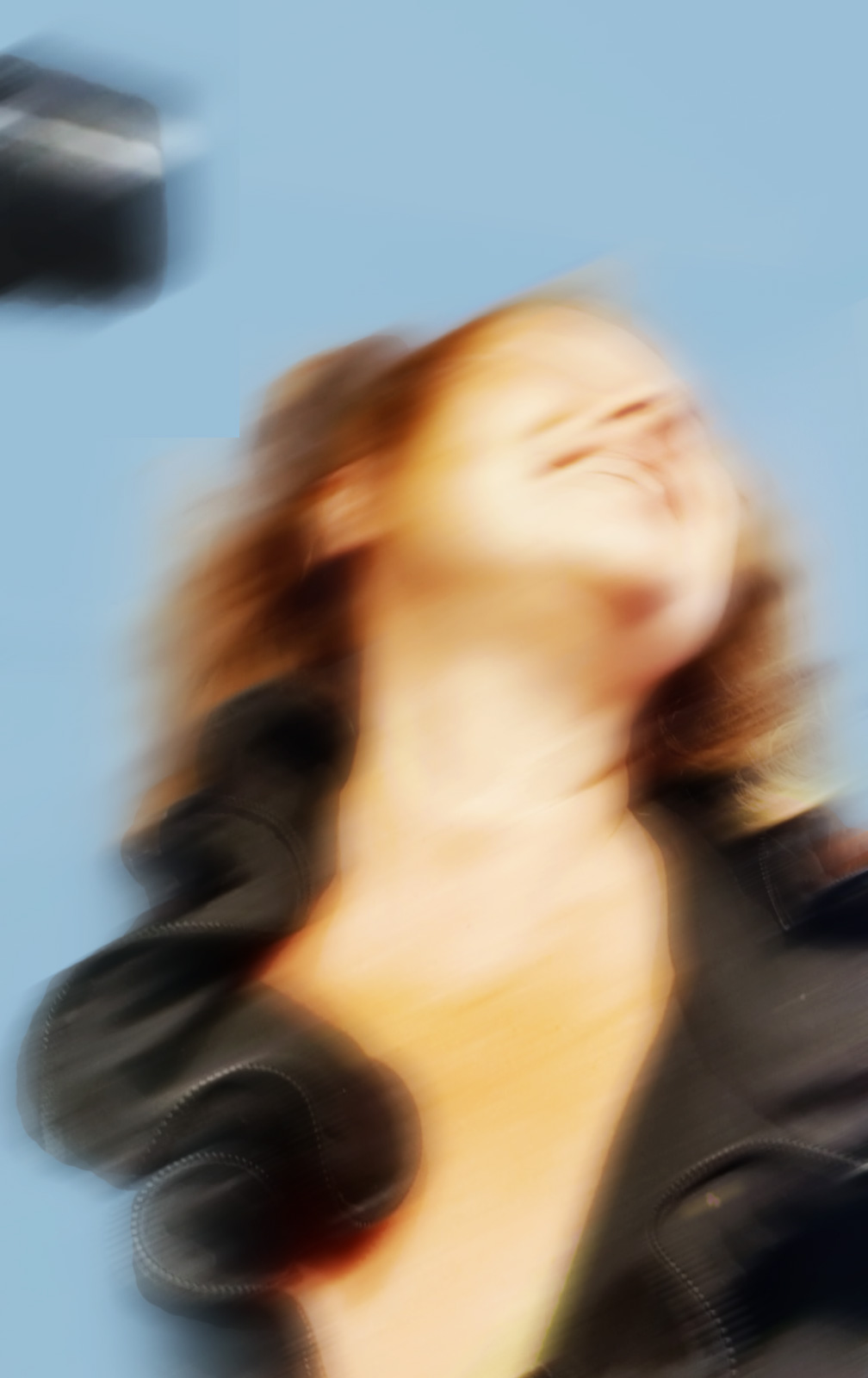

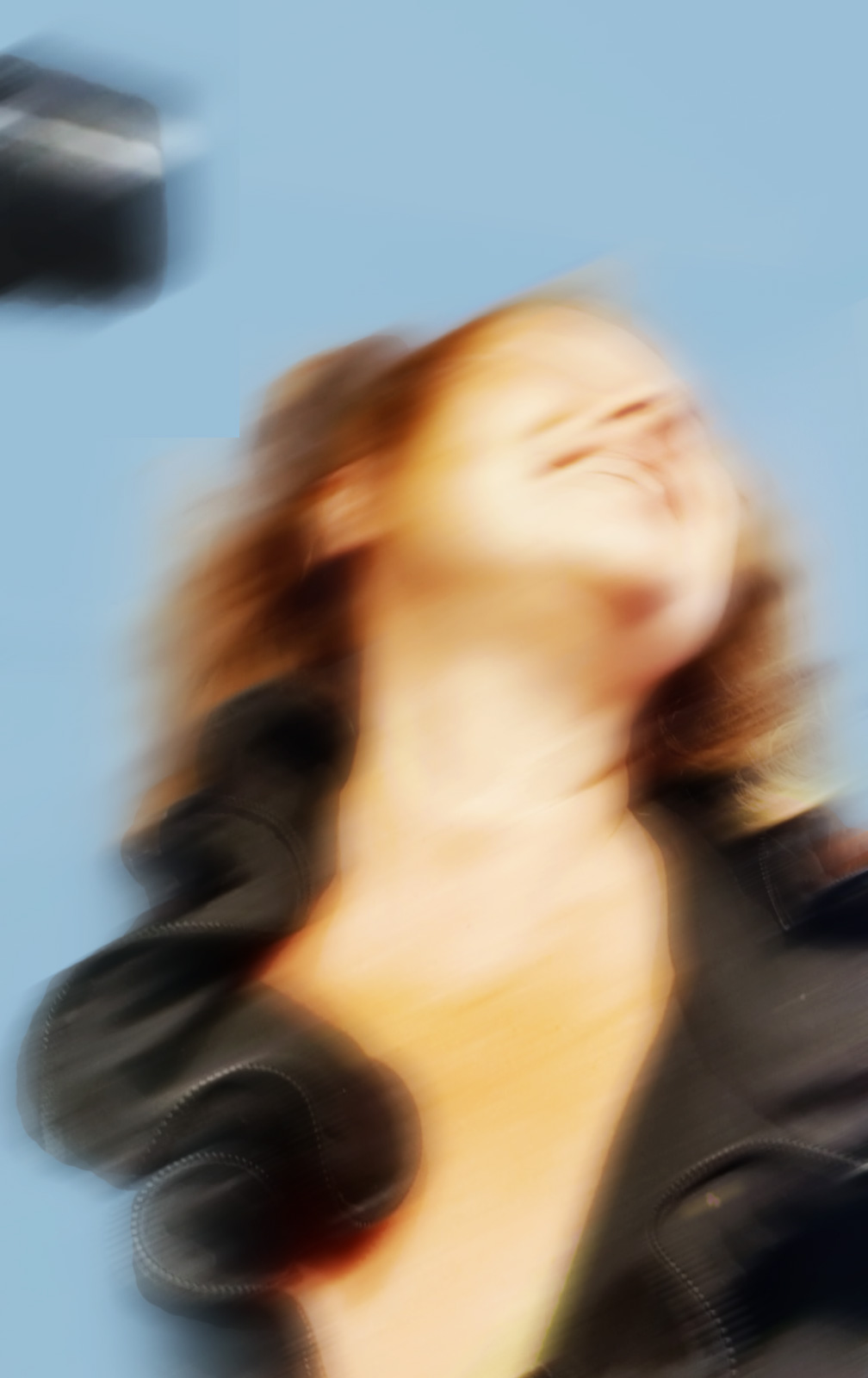
Kunst, Kollektives Trauma & Corona
Ein neurophysiologischer Fön für die angstgefrorenen Meere in uns
Kollektives Trauma – eine Kumulation gerissener Gewebe
Vor einigen Tagen hörte ich den sehr empfehlenswerten Podcast https://www.youtube.com/watch?v=7lFp38vktRQ von Verena König über die Frage, ob wir gerade ein kollektives Trauma erleben. “Kollektives Trauma”- das ist ein großer Begriff, der erstmal gefüllt werden will. Eine einfache Definition ist, dass ein Trauma dann einsetzt, wenn etwas geschieht, das unsere Bewältigungsmöglichkeiten überfordert. Und wenn die Bewältigungsmöglichkeiten von vielen Menschen überfordert sind, wächst die Gefahr eines kollektiven Traumas. Einzelne Erschütterte können dann kein tragendes Netz mehr erleben, dass eine Weile ihr eigenes gerissenes Gewebe ersetzen könnte, so dass diese Art der sozialen Bewältigung wegbricht. Das Gewebe einer Gesellschaft wird dadurch als ganzes immer poröser und weniger tragfähig.
Wir sind so ungeübt, Verletzungen zu beantworten
Corona bedeutet nicht nur Not als Folge der Erkrankung und der Maßnahmen. Es ist auch die Not, dass sich unsere Gesellschaft in der Beantwortung von Trauma so erschreckend hilflos zeigt. Das erscheint beinahe umgekehrt proportional zu der materiell und in Bezug auf die Gesundheitsversorgung weltweit privilegierten Situation, die wir in Deutschland und anderen Industrienationen erleben. Wir tun uns schwer damit, ein Nest nicht nur mit stabiler, doppelt geprüfter Statik zu schaffen, sondern auch mit Wärme zu füllen, wenn Verwundetes dort Zuflucht sucht. Wir sind dann geneigt, Verletztes plötzlich als Kuckuckskind wahrzunehmen, das nicht mehr als Teil des Nestes ist, sondern Störfaktor. Ein Fehler im System, den wir wahlweise als bedeutungslos bagatellisieren, in einer Krypta einzuschließen versuchen oder möglichst schnell in professionelle Hände geben wollen.
Ein blinder Fleck in der Mitte unseres Hauses
Trotz oder vielleicht gerade wegen der medialen Überflutung mit Schreckensbildern ist das, was uns einen fühlenden Zugang zu unseren eigenen Verletzungen und denen anderer Menschen eröffnet, wie ein blinder Fleck, wie ein verschlossener Raum in dem vielkammerigen Haus, das wir sind. Trauma ist in unserer Mitte, aber nicht als etwas, das beantwortet, gesehen, integriert und in seinen Kräften vielleicht sogar genutzt werden kann. Es ist wie ein unzugängliches Zimmer im Zentrum unseres Hauses, ein Ort der gleichsam zu wenig zu wenig sichtbar ist und trotzdem das gesamte Leben im Haus beeinflusst.
Warum wir die Kunst gerade jetzt brauchen
Kunst und Kultur spielen eine ganz wesentliche Rolle, um gerissene Gewebe nicht nur für unseren Verstand, sondern auch unsere Fühlfähigkeit sichtbar zu machen. Wir brauchen es gerade jetzt, das Verwundetes und Starkes sowohl in und selber wie auch der Gesellschaft an einen Wärmestrom der Lebendigkeit angebunden wird. Wir brauchen es, das “Ich bin nicht alleine.” sowohl in unseren Verletzungsempfindungen Überforderungen, und Verstörtheiten zu fühlen, wie auch in der Kraft von Neugestaltung.
Polyvagaltheory – ein Ausflug in die Neurophysiologie
Um zu verstehen, warum es gerade im Moment so wichtig ist, uns als Gestalter, als Schöpfer, als Mitkünstler füreinander, zu erleben, lohnt sich die Polyvagaltheorie von Stephen Porges. Sie beschreibt anschaulich, wie existenzieller Stress unser Nervensystem beeinflusst. Die drei traumatischen Muster sind Kampf, Flucht und Erstarrung.
Wie sich traumatische Reaktionen aktuell zeigen
Zu den aktiven, aus dem sympathischen Teil des Nervensystems eingeleiteten Muster gehören Kampf oder Flucht. Wer beispielsweise die Diskussionen in den sozialen Medien mitverfolgt, hat oft den Eindruck, sie werden mit der ganzen Härte eines Vernichtungskampfes geführt. Es ist der hilflose Versuch, in einer Situation der Ungewissheit einen Täter auffindig zu machen, der bekämpft werden kann. Die Neurophysiologie des Traumas eröffnet einen anderen Blick auf die aggressiv aufgeladene gesellschaftliche Spaltung, die wir gerade erleben. Die Angst, Teil unseres Fluchtinstinkts, schwappt aus allen Meinungslagern. Sie äußert sich nicht nur in Panikstörungen, sondern auch allen Arten von extremem Vermeidungsverhalten. Der aus dem parasympathischen Teil des Nervensystem entstehende Aspekt der traumatischen Reaktion, der laut Porges vom dorsalen Teil des Vagusnerven beeinflusst wird, ist Erstarrung, Lähmung, Unterwerfung – das verzweifelte Bemühen unserer emotionalen Augen, sich so lange zu verschließen und unsere Gefühle abzuschalten, bis die Situation vorbei ist. Das öffnet die Tür für die Weltstumpfheit von Depressionen, die kollektiv gerade ein erschreckendes Ausmaß angenommen haben.
Gemeinschaft, Neugier und Kreativität als neuronale Gegenbewegung
Die Gegenbewegung dazu, die laut Stephen Porges den ventralen Vagus aktiviert – den unser Nervensystem wieder regenerierenden Modus – setzt sich aus drei Teilen zusammen: Erleben von Gemeinschaft, Exploration im Sinne von Neugier auf Neues und Kreativität. Diese Kräfte sind nicht nur Schokostreusel auf der Kirsche auf dem Sahnehäubchen, sondern existenziell notwendigen Nahrung, die wir für die Bewältigungskraft angesichts der aktuellen Herausforderung brauchen. Bewältigungskraft bedeutet hier, die unbedingt notwendigen Fähigkeiten zur Neugestaltung in uns zu pflegen. Wir brauchen diese Kräfte, weil die jetzige Zeit Spuren in unseren individuellen Geweben und dem Gefüge der Gesellschaft hinterlässt, die andere Antworten brauchen, als die Versuche einen Status Quo wiederherzustellen.
Ein wärmender Fön für den Strom unserer Lebendigkeit
Wir brauchen es dazu, dass der verschlossene Raum des Traumas in unserer Mitte geöffnet wird und mit Wärme durchflutet, damit er unser Leben nicht lähmt. Wir brauchen Kunst und Kultur als einen unserer Raumöffner, als – wie Kafka es nannte „ Axt für das gefrorene Meer in uns“ – oder vielmehr als wärmender Fön für die erstarrten Eishöhlen, die unser aller Gestaltungskräfte manchmal umgeben.
Kunst, Kollektives Trauma & Corona
Ein neurophysiologischer Fön für die angstgefrorenen Meere in uns
Kollektives Trauma – eine Kumulation gerissener Gewebe
Vor einigen Tagen hörte ich den sehr empfehlenswerten Podcast https://www.youtube.com/watch?v=7lFp38vktRQ von Verena König über die Frage, ob wir gerade ein kollektives Trauma erleben. “Kollektives Trauma”- das ist ein großer Begriff, der erstmal gefüllt werden will. Eine einfache Definition ist, dass ein Trauma dann einsetzt, wenn etwas geschieht, das unsere Bewältigungsmöglichkeiten überfordert. Und wenn die Bewältigungsmöglichkeiten von vielen Menschen überfordert sind, wächst die Gefahr eines kollektiven Traumas. Einzelne Erschütterte können dann kein tragendes Netz mehr erleben, dass eine Weile ihr eigenes gerissenes Gewebe ersetzen könnte, so dass diese Art der sozialen Bewältigung wegbricht. Das Gewebe einer Gesellschaft wird dadurch als ganzes immer poröser und weniger tragfähig.
Wir sind so ungeübt, Verletzungen zu beantworten
Corona bedeutet nicht nur Not als Folge der Erkrankung und der Maßnahmen. Es ist auch die Not, dass sich unsere Gesellschaft in der Beantwortung von Trauma so erschreckend hilflos zeigt. Das erscheint beinahe umgekehrt proportional zu der materiell und in Bezug auf die Gesundheitsversorgung weltweit privilegierten Situation, die wir in Deutschland und anderen Industrienationen erleben. Wir tun uns schwer damit, ein Nest nicht nur mit stabiler, doppelt geprüfter Statik zu schaffen, sondern auch mit Wärme zu füllen, wenn Verwundetes dort Zuflucht sucht. Wir sind dann geneigt, Verletztes plötzlich als Kuckuckskind wahrzunehmen, das nicht mehr als Teil des Nestes ist, sondern Störfaktor. Ein Fehler im System, den wir wahlweise als bedeutungslos bagatellisieren, in einer Krypta einzuschließen versuchen oder möglichst schnell in professionelle Hände geben wollen.
Ein blinder Fleck in der Mitte unseres Hauses
Trotz oder vielleicht gerade wegen der medialen Überflutung mit Schreckensbildern ist das, was uns einen fühlenden Zugang zu unseren eigenen Verletzungen und denen anderer Menschen eröffnet, wie ein blinder Fleck, wie ein verschlossener Raum in dem vielkammerigen Haus, das wir sind. Trauma ist in unserer Mitte, aber nicht als etwas, das beantwortet, gesehen, integriert und in seinen Kräften vielleicht sogar genutzt werden kann. Es ist wie ein unzugängliches Zimmer im Zentrum unseres Hauses, ein Ort der gleichsam zu wenig zu wenig sichtbar ist und trotzdem das gesamte Leben im Haus beeinflusst.
Warum wir die Kunst gerade jetzt brauchen
Kunst und Kultur spielen eine ganz wesentliche Rolle, um gerissene Gewebe nicht nur für unseren Verstand, sondern auch unsere Fühlfähigkeit sichtbar zu machen. Wir brauchen es gerade jetzt, das Verwundetes und Starkes sowohl in und selber wie auch der Gesellschaft an einen Wärmestrom der Lebendigkeit angebunden wird. Wir brauchen es, das “Ich bin nicht alleine.” sowohl in unseren Verletzungsempfindungen Überforderungen, und Verstörtheiten zu fühlen, wie auch in der Kraft von Neugestaltung.
Polyvagaltheory – ein Ausflug in die Neurophysiologie
Um zu verstehen, warum es gerade im Moment so wichtig ist, uns als Gestalter, als Schöpfer, als Mitkünstler füreinander, zu erleben, lohnt sich die Polyvagaltheorie von Stephen Porges. Sie beschreibt anschaulich, wie existenzieller Stress unser Nervensystem beeinflusst. Die drei traumatischen Muster sind Kampf, Flucht und Erstarrung.
Wie sich traumatische Reaktionen aktuell zeigen
Zu den aktiven, aus dem sympathischen Teil des Nervensystems eingeleiteten Muster gehören Kampf oder Flucht. Wer beispielsweise die Diskussionen in den sozialen Medien mitverfolgt, hat oft den Eindruck, sie werden mit der ganzen Härte eines Vernichtungskampfes geführt. Es ist der hilflose Versuch, in einer Situation der Ungewissheit einen Täter auffindig zu machen, der bekämpft werden kann. Die Neurophysiologie des Traumas eröffnet einen anderen Blick auf die aggressiv aufgeladene gesellschaftliche Spaltung, die wir gerade erleben. Die Angst, Teil unseres Fluchtinstinkts, schwappt aus allen Meinungslagern. Sie äußert sich nicht nur in Panikstörungen, sondern auch allen Arten von extremem Vermeidungsverhalten. Der aus dem parasympathischen Teil des Nervensystem entstehende Aspekt der traumatischen Reaktion, der laut Porges vom dorsalen Teil des Vagusnerven beeinflusst wird, ist Erstarrung, Lähmung, Unterwerfung – das verzweifelte Bemühen unserer emotionalen Augen, sich so lange zu verschließen und unsere Gefühle abzuschalten, bis die Situation vorbei ist. Das öffnet die Tür für die Weltstumpfheit von Depressionen, die kollektiv gerade ein erschreckendes Ausmaß angenommen haben.
Gemeinschaft, Neugier und Kreativität als neuronale Gegenbewegung
Die Gegenbewegung dazu, die laut Stephen Porges den ventralen Vagus aktiviert – den unser Nervensystem wieder regenerierenden Modus – setzt sich aus drei Teilen zusammen: Erleben von Gemeinschaft, Exploration im Sinne von Neugier auf Neues und Kreativität. Diese Kräfte sind nicht nur Schokostreusel auf der Kirsche auf dem Sahnehäubchen, sondern existenziell notwendigen Nahrung, die wir für die Bewältigungskraft angesichts der aktuellen Herausforderung brauchen. Bewältigungskraft bedeutet hier, die unbedingt notwendigen Fähigkeiten zur Neugestaltung in uns zu pflegen. Wir brauchen diese Kräfte, weil die jetzige Zeit Spuren in unseren individuellen Geweben und dem Gefüge der Gesellschaft hinterlässt, die andere Antworten brauchen, als die Versuche einen Status Quo wiederherzustellen.
Ein wärmender Fön für den Strom unserer Lebendigkeit
Wir brauchen es dazu, dass der verschlossene Raum des Traumas in unserer Mitte geöffnet wird und mit Wärme durchflutet, damit er unser Leben nicht lähmt. Wir brauchen Kunst und Kultur als einen unserer Raumöffner, als – wie Kafka es nannte „ Axt für das gefrorene Meer in uns“ – oder vielmehr als wärmender Fön für die erstarrten Eishöhlen, die unser aller Gestaltungskräfte manchmal umgeben.